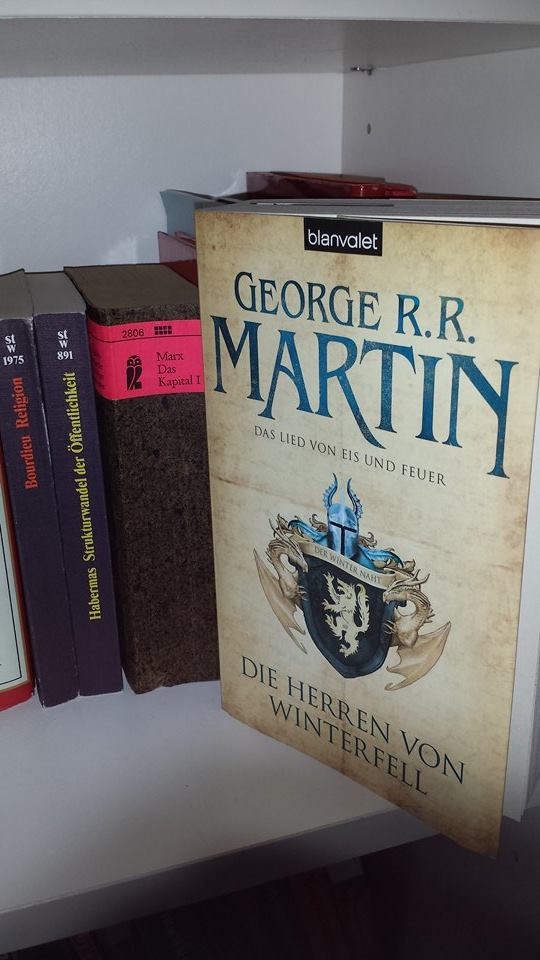Auf dem Parteitag der Linkspartei in Magdeburg wollten die unterschiedlichen Parteiflügel eigentlich darüber diskutieren, wie der Kuchen in Zeiten des Flüchtlingssterbens vor den Küsten Italiens und der griechischen Inseln verteilt werden solle. Eine ernsthafte Debatte wurde dann jäh dank eines Aktivisten in den Hintergrund gedrängt, der Sarah Wagenknecht zumindest in Magdeburg einen sehr großen Teil vom Kuchen zugestand. Obwohl führende Linken-GenossInnen die Aktion unisono verurteilten, konnte dies nicht über den Unmut weiter Teile der Partei mit den jüngsten Äußerungen Sarah Wagenknechts über Obergrenzen und die Kritik an einem u.a. von der SPD diskutierten Einwanderungsgesetz hinwegtäuschen. Wagenknecht und ihrem Lebensgefährten Lafontaine war vorgeworfen worden, dadurch, einen angeblichen Verteilungskonflikt zwischen einheimischen ArbeitnehmerInnen und Flüchtlingen zu problematisieren, in den Gewässern der AfD zu fischen, mit der wahrscheinlichen Konsequenz am Ende die RechtspopulistInnen zu stärken.
Konkret sagte die Linken-Politikerin dem „Redaktions-Netzwerk Deutschland“: „Deutschland braucht kein Einwanderungsgesetz, sondern eine Wiederherstellung des Sozialstaats. In einer Gesellschaft, die sozial zerfällt und in der die Ungleichheit immer weiter wächst, kann auch keine Integration gelingen.“ Außerdem sei der primäre Effekt eines Einwanderungsgesetzes unter heutigen Bedingungen, die Lohnkonkurrenz zu verschärfen und den Unternehmen Lohndumping zusätzlich zu erleichtern, so Wagenknecht weiter.
Ein solches Argument aus dem Halse einer Linken-Politikerin wirkt schief wie eine Torticollis, weil die Nuancierung „unter heutigen Bedingungen“ höchstwahrscheinlich am Ende nicht in der Öffentlichkeit hängen bleiben wird, sondern bloß die vermeintliche Kausalkette „mehr Zuwanderung gleich mehr Lohndumping“. Bei dieser Annahme handelt es sich bei genauer Betrachtung um keine gültige Schlussfolgerung und auf gar keinen Fall um ein linkes Argument. Die Argumentation ist vielmehr ein Trojanisches Pferd der Neuen Rechten, um im ArbeitnehmerInnenmilieu zu wildern und diejenigen, die eine äneische Flucht auf sich nahmen, zu instrumentalisieren um die politische Linke zugunsten der extremen Rechten zu schwächen. Der Philosoph, Vordenker der französischen Neuen Rechten und Vorsitzende des identitären Think Tanks „GRECE“ (Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne, <> Paris) Alain de Benoist hatte 2011 in einem Artikel die Immigration als die industrielle Reservearmee des Kapital bezeichnet (L’immigration: L’armee reserve du capital). In der Überschrift übernimmt er die Metapher der „Industriellen Reservearmee“ aus Karl Marx‘ erstem Band des Kapitals. Sie fügt sich nahtlos in die neuerliche Querfrontstrategie des Front National ein, durch die Übernahme protektionistischer Elemente aus dem wirtschaftspolitischen Programm der KPF (Kommunistische Partei Frankreichs) der 1980er Jahre in den nicht-migrantischen ArbeitnehmerInnenmilieus zu fischen. Die Behauptung, Zuwanderung führe zwangsläufig zu Lohndumping fand schließlich Eingang in das Programm des FN.
Dass die xenophobe Auslegung der Marx’schen Metapher der Industriellen Reservearmee weder auf der Theorieebene noch in der praktischen Politik haltbar ist, lässt sich allerdings schon durch einen Blick in das Original selbst werfen. Dort heißt es:
„Im großen und ganzen sind die allgemeinen Bewegungen des Arbeitslohns ausschließlich reguliert durch die Expansion und Kontraktion der industriellen Reservearmee, welche dem Periodenwechsel des industriellen Zyklus entsprechen. Sie sind also nicht bestimmt durch die Bewegung der absoluten Anzahl der Arbeiterbevölkerung, sondern durch das wechselnde Verhältnis, worin die Arbeiterklasse in aktive Armee und Reservearmee zerfällt, durch die Zunahme und Abnahme des relativen Umfangs der Übervölkerung, durch den Grad, worin sie bald absorbiert, bald wieder freigesetzt wird“, durch den Grad, worin sie bald absorbiert, bald wieder freigesetzt wird. Für die moderne Industrie mit ihrem zehnjährigen Zyklus und seinen periodischen Phasen, die außerdem im Fortgang der Akkumulation durch stets rascher aufeinander folgende unregelmäßige Oszillationen durchkreuzt werden, wäre es in der Tat ein schönes Gesetz, welches die Nachfrage und Zufuhr von Arbeit nicht durch die Expansion und Kontraktion des Kapitals, also nach seinen jedesmaligen Verwertungsbedürfnissen regelte, so daß der Arbeitsmarkt bald relativ untervoll erscheint, weil das Kapital sich expandiert, bald wieder übervoll, weil es sich kontrahiert, sondern umgekehrt die Bewegung des Kapitals von der absoluten Bewegung der Bevölkerungsmenge abhängig machte.“ (Karl Marx, MEW 23, 666).
Im zitierten Abschnitt wird schlüssig beschrieben, dass erstens nicht die absolute Zahl, sondern nur die relative Expansions- und Kontraktionsdynamik infolge des Konjunkturzyklus die Zahl der Arbeitslosigkeit bestimmen und ansonsten noch die Möglichkeit der gesteuerten Kapitalexpansion bei expansiver Bevölkerungsentwicklung besteht, ein Vorgriff auf keynesianische Vorstellungen von staatlichen Investitionen und öffentlicher Beschäftigungspolitik im konjunkturellen Abschwung. Das von Marx im Folgeabsatz erwähnte Risiko, dass sodann „infolge der Kapitalakkumulation der Arbeitslohn [stiege und] der erhöhte Arbeitslohn zur rascheren Vermehrung der Arbeiterbevölkerung [ansporne], und diese [fortdauere], bis der Arbeitsmarkt überfüllt [sei], also das Kapital relativ zur Arbeiterzufuhr unzureichend geworden [sei], kann man auf Basis empirischer Beobachtungen des demographischen Wandels bei steigendem Wohlstand aus der Gegenwartsperspektive leicht abräumen (vgl. ebd. 666).
Wie gefährlich es für die Linke ist, diesem offensichtlich von rechtspopulistischen Kreisen in die Welt gesetzten Trojanischen Pferd bloß in der Hoffnung auf ein paar potenzielle Proteststimmen entgegen zu kommen, anstatt selbstbewusst die Gegenargumentation aufzunehmen, haben die Erfahrungen von Aufstieg und Niedergang einerseits der KPF und andererseits des Front National in Frankreich gezeigt. Auch der frühere KPF-Vorsitzende George Marchais war 1981 für kurze Zeit der „zuwanderungskritischen“ Rhetorik verfallen, nur um danach wieder zurückzurudern, um schließlich beobachten zu müssen, wie das Übel der Fremdenfeindlichkeit danach nicht mehr zurück in die Büchse der Pandora zu bekommen war. Die Konsequenzen in Gestalt aktueller Umfragewerte des Front National kennen wir im Jahre 2016 zur Genüge.
Chris O. King studiert internationale Politische Ökonomie in Leeds.
Foto: Jürgen Rutsatz / pixelio.de